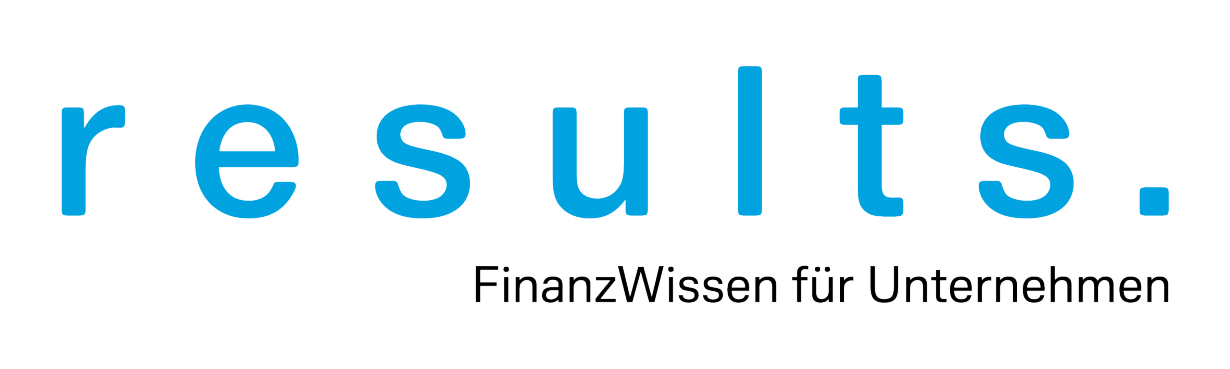
Against All Odds
Das Projekt Europa ist einzigartig. Hat es eine Chance?

Am 19. März 1958 trafen sich in der Europäischen Parlamentarischen Versammlung erstmals 142 Gesandte. Zu entscheiden hatten sie nichts. Heute ist das Europäische Parlament mit einigen Befugnissen ausgestattet, aber die wesentlichen Entscheidungen werden immer noch in den nationalen Hauptstädten gefällt. FOTO: PICTURE ALLIANCE/DPA/LAURENT DUBRULE
Die Geschichte Europas ist eine Geschichte des Kriegs. Noch nie hat eine einzelne Macht den kleinen Kontinent beherrscht, selbst das Römische Reich endete im südlichen Deutschland. Unzählige Völker rangen über Jahrtausende in kleinem und großem Stil um Macht und Dominanz, um Ideen und Religionen. Die Auseinandersetzungen kulminierten in den zwei gigantischen Kriegen des 20. Jahrhunderts, die die Bezeichnung Weltkrieg erhielten, aber beide ihren Ursprung in Europa hatten und dort gewaltige Zerstörung verursachten.
Seitdem herrscht (weitestgehend) Friede. Dass dieser jüngst brüchig geworden ist, stellt Europa vor große Herausforderungen, ist aber auch eine Chance für den Einigungsprozess. Das Projekt Europa – die allmähliche, immer stärkere Verzahnung einer wachsenden Zahl von Nationalstaaten – ist historisch gesehen einzigartig. Nach aller Erfahrung müsste das Projekt längst gescheitert sein. Es brauchte eine ganz besondere Gemengelage, damit aus einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl der drei Länder (West-)Deutschland, Frankreich und Belgien im Laufe von 73 Jahren eine Europäische Union mit aktuell 27 Mitgliedern und neun Beitrittskandidaten werden konnte.
Benachbarte Staaten liegen oft im Zwist und schließen sich nur gegen Feinde von außen zusammen.
Das ist eine historische Sensation, denn freiwillige Zusammenschlüsse von Staaten sind eine große Ausnahme. Immerhin: 1814 schlossen sich Norwegen und Schweden zu einem Staatenbund zusammen (bis 1905 bei einer Volksabstimmung 368 392 Norweger für und nur 184 gegen die Auflösung der Union stimmten). Doch fast alle Vereinigungen sind Eroberungen, die in eine Assimilierung oder einen Vielvölkerstaat münden. Benachbarte Staaten liegen oft im Zwist und schließen sich nur gegen Feinde von außen zusammen: in der Antike die griechischen Städte im Hellenischen Bund gegen die Perser, im Mittelalter die oberitalienischen Stadtstaaten im Lombardischen Bund gegen Kaiser Barbarossa. In beiden Fällen galt: Sobald die äußere Gefahr gebannt war, schlug man sich wieder gegenseitig die Köpfe ein.
Was könnten Treiber sein, die Staaten zu einer Aufgabe ihrer Souveränität bewegen? Religionen haben in Europa zu vielen Kriegen geführt, zum Beispiel zur Jahrhunderte andauernden Vertreibung muslimischer Herrscher aus Südeuropa und zum Dreißigjährigen Krieg. Zu freiwilligen Zusammenschlüssen kam es nicht. Auch politische Ideen haben versagt: Demokratie, Kommunismus und Faschismus führten zu Allianzen, aber nicht zu gemeinsamen Staaten. Selbst die 13 neuenglischen Kolonien schlossen sich nicht aus demokratischer Überzeugung zu den Vereinigten Staaten von Amerika zusammen, sondern zum gemeinsamen Kampf gegen die Kolonialmacht. Das Gleiche gilt für die demokratische Eidgenossenschaft Schweiz, die sich gegen die umliegenden Großmächte schützen musste.
Lockruf Nationalstaat
Die einzige Vision, die tatsächlich Staaten ohne Druck von außen zu einer freiwilligen Vereinigung bewogen hat, ist die nationale Idee. Die Identifikation einer Gruppe als Nation entfaltete im 19. Jahrhundert eine gewaltige Wirkmacht, die Vielvölkerstaaten wie dem Habsburger und dem Osmanischen Reich den Garaus machte. In Deutschland dagegen wurde daraus eine einigende Kraft, die unter preußischer Führung mit Kriegen gegen Dänemark und Frankreich über den Norddeutschen Bund bis zum Deutschen Reich führte. „Es kommt zusammen, was zusammengehört“, war damals vielerorts zu hören.
... mich für den monatlichen Newsletter registrieren.
Spannende Informationen und relevante Themen aus der Wirtschaft und Finanzwelt in kompakter Form für Ihren unternehmerischen Alltag und für Ihre strategischen Entscheidungen.
Wir machen Wirtschaftsthemen zu einem Erlebnis.
Die einzige Vision, die tatsächlich Staaten ohne Druck von außen zu einer freiwilligen Vereinigung bewogen hat, ist die nationale Idee.
Was in Deutschland (und auch in Italien) funktionierte, ist allerdings kein Selbstläufer. Der ägyptische Machthaber Gamal Abdel Nasser versuchte, einen gemeinsamen Staat aller Araber ins Leben zu rufen. Immerhin schlossen sich 1958 Ägypten und Syrien zur Vereinigten Arabischen Republik zusammen. Damit suchten die Syrer Schutz vor der Türkei, bekamen de facto aber eine ägyptische Herrschaft. Nach nur drei Jahren putschte die syrische Armee und beendete die Union tags darauf – und damit auch alle panarabischen Träume. Bis heute ist kein arabischer Herrscher zur Aufgabe seiner Souveränität bereit.
Und es gibt ein weiteres Problem: Nationen kann man nicht einfach definieren. Das ungeheuer schwierige Nation Building in den willkürlich und oft mit dem Lineal gezogenen postkolonialen Staaten zeigt, wie wichtig kulturelle und sprachliche Gemeinsamkeiten sind. Europa hat beides nicht. Aber was war dann die besondere Gemengelage, die eine EU möglich machte? Vier Punkte kamen zusammen: Niemand wollte mehr Krieg, die Nationen suchten Schutz voreinander, der befreundete Hegemon USA drang auf Kooperation – und mit der kommunistischen Sowjetunion war ein neuer gemeinsamer Gegner erwachsen.
Weckruf Wertegemeinschaft
Das trug viele Jahrzehnte lang. Doch aktuell steht das Projekt Europa unter Druck. Die Entscheidung, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs stark und rasch zu erweitern, hat zu mehr Breite geführt, erschwert aber die Vertiefung der Union. Die Briten haben sich wie dereinst die Norweger im Bund mit den Schweden dafür entschieden, künftig wieder allein zu marschieren. Das politische Selbstverständnis der EU-Staaten ist sehr unterschiedlich und der Tendenz nach divergierend. Der Hegemon, der lange die schützende Hand über den Kontinent hielt, droht sich zurückzuziehen. Dafür ist der gemeinsame Gegner zurückgekehrt.
Vielleicht wird Europa die erste echte Wertegemeinschaft der Weltgeschichte – es ist vermutlich die einzige Chance für dieses unvergleichliche Projekt.
Allen ist klar: Einzeln können die europäischen Nationalstaaten ihre Interessen nicht durchsetzen. Der kleine Kontinent wird global nicht als dominierender Spieler, sondern als kranker Mann wahrgenommen. Es geht also nur mit vereinten Kräften, doch die Geschichte lehrt: Ohne gemeinsame Identifikation muss die Vision scheitern. Aber welche Idee, welches Ideal steckt hinter dem Projekt Europa? Sich gegen einen gemeinsamen Gegner im physischen Abwehrkampf zusammenrotten zu müssen, führt nicht zu dauerhafter Integration.
Doch Europa hat mehr zu verteidigen als seine Grenzen, nämlich eine Lebensanschauung, deren Prämissen weltweit immer mehr angezweifelt werden. Die freiheitliche Ordnung mit individuellen unverletzlichen Rechten könnte die Vision sein, die alle eint. Vielleicht wird Europa die erste echte Wertegemeinschaft der Weltgeschichte – es ist vermutlich die einzige Chance für dieses unvergleichliche Projekt.
06/2024
Chefredaktion: Bastian Frien und Boris Karkowski (verantwortlich im Sinne des Presserechts). Der Inhalt gibt nicht in jedem Fall die Meinung des Herausgebers (Deutsche Bank AG) wieder.


